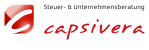Corona – Informationen
für Unternehmen, Selbständige, Vermieter und Arbeitnehmer
für Unternehmen, Selbständige, Vermieter und Arbeitnehmer
Sie haben Probleme wegen Corona und benötigen einen Partner und sofortige Hilfe?
Um die Vielzahl der Anfragen möglichst effektiv bearbeiten zu können, haben wir ein Anforderungsformular für Sie erstellt. Bitte nutzen Sie dieses um uns Ihren Bedarf anzumelden. Wir melden uns dann zeitnah bei Ihnen.
Aktuelle Blogbeiträge zu Corona:
Wir haben Ihnen eine Übersicht zu aktuellen Themen in der Corona-Krise zusammengestellt. Diese Übersicht wird täglich überarbeitet:
- Corona
- COV-Arbeitgeber-Arbeitnehmer
- COV-Insolvenz
- COV-Kredite / Hilfsfonds / Entschädigungen
- COV-Steuern
- COV-Versicherungen
Presseberichten zufolge wird noch evaluiert, ob eine Verlängerung der Abgabefristen für Steuererklärungen
oder andere geeignete Maßnahmen erforderlich und umsetzbar sind. Das Ergebnis steht noch nicht fest.
Stand: 20.03.2020
Der Arbeitgeber hat nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) grundsätzlich die Verpflichtung, die Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit für seine Beschäftigten am Arbeitsplatz zu beurteilen (sog. Gefährdungsbeurteilung) und Maßnahmen hieraus abzuleiten, die ihm möglich und zumutbar sind.
Im Rahmen der Pandemieplanung (Bevölkerungsschutz) hat der Arbeitgeber ggf. weitere Maßnahmen zu ermitteln und durchzuführen.
Konkrete Hinweise hierzu finden sich zum Beispiel im Nationalen Pandemieplan auf der Webseite des Robert Koch Instituts.
Die Arbeitnehmer sind nach §§ 15, 16 ArbSchG verpflichtet, jede erhebliche Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit unverzüglich dem Arbeitgeber zu melden und dessen arbeitsschutzrechtlichen Weisungen nachzukommen.
Quelle: BDA, Arbeitsrechtliche Folgen einer Pandemie, BMG: Tagesaktuelle Informationen zum Coronavirus
Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV Spitzenverband) und die Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) haben eine zeitlich befristete erleichterte Möglichkeit für Krankschreibungen vereinbart. Patienten, die an leichten Erkrankungen der oberen Atemwege erkrankt sind und keine schwere Symptomatik vorweisen oder Kriterien des Robert Koch Instituts für einen Verdacht auf eine Infektion erfüllen, können nach telefonischer Rücksprache mit ihrem Arzt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bis maximal sieben Tage ausgestellt bekommen. Die Vereinbarung gilt seit dem 9. März und ist zunächst für vier Wochen befristet.
Die Bundesregierung bereitet derzeit eine gesetzliche Regelung vor, um von der Corona-Pandemie betroffene Unternehmen vor Insolvenzen zu schützen.
Ziel ist es, die Insolvenzantragspflicht bis zum 30.09.2020 für die betroffenen Unternehmen auszusetzen.
Voraussetzung für die Aussetzung soll sein, dass der Insolvenzgrund auf den Auswirkungen der Corona-Epidemie beruht und dass aufgrund einer Beantragung öffentlicher Hilfen bzw. ernsthafter Finanzierungs- oder Sanierungsverhandlungen eines Antragspflichtigen begründete Aussichten auf Sanierung bestehen. Darüber hinaus soll eine Verordnungsermächtigung für das BMJV für eine Verlängerung der Maßnahme höchstens bis zum 31.03.2021 vorgeschlagen werden.
Mit dieser Maßnahme soll verhindert werden, dass Unternehmen nur deshalb Insolvenz anmelden müssen, weil die von der Bundesregierung beschlossenen Hilfen nicht rechtzeitig bei ihnen ankommen. Die reguläre Drei-Wochen-Frist der Insolvenzordnung soll daher für diese Fälle nicht gelten.
Die Maßnahme orientiert sich an vergleichbaren Regelungen, die schon bei den Hochwasserkatastrophen 2002, 2013 und 2016 angewendet worden waren.
In der Regel sind Unternehmen nur selten gegen das Risiko eines Betriebsausfalls aufgrund von Seuchen und Epidemien abgesichert. Für die Versicherer zählt eine Pandemie – also eine Seuche, die sich über mehrere Länder oder gar Kontinente ausbreitet – zu den sogenannten Kumulrisiken. Damit sind Gefahren gemeint, die in relativ kurzer Zeit sehr viele Schäden anrichten.
Zwar gibt es Policen, die Ertragsausfälle aufgrund von Betriebsunterbrechungen abdecken. Ebenso gibt es Versicherungen, mit denen sich Veranstalter gegen den Ausfall von Konzerten oder Messen wappnen können. Die Produkte decken standardmäßig aber nur Schäden ab, die auf Brand, Diebstahl, Sturm oder sonstige Naturgefahren zurückgehen. Zwar kann der Schutz ergänzt werden – beispielsweise auf
Betriebsschließungen infolge vertraglich vereinbarter übertragbarer Krankheiten. Doch das ist zumindest mit Blick auf die klassischen Versicherungsprodukte eher selten der Fall. Betroffene sollten sich zur Klärung an ihren Versicherer wenden.
Quelle und weitere Informationen: GDV – Warum Seuchen selten mitversichert sind
Wer aufgrund des Infektionsschutzgesetzes einem Tätigkeitsverbot unterliegt (§§ 31, 42 IfSG) oder einer Quarantäne (§ 30 IfSG) unterliegt oder unterworfen wird bzw. wurde kann eine Entschädigung nach §§ 56 ff. IfSG beantragen.
Voraussetzung ist in beiden Fällen ein die Person betreffender Bescheid des Gesundheitsamtes zum persönlichen Tätigkeitsverbot oder zur angeordneten Quarantäne und ein Verdienstausfall.
Eine Erstattung des Verdienstausfalls kommt gem. § 56 Abs. 3 IfSG in Betracht. Bei einer Existenzgefährdung kann ferner „Ersatz der in dieser Zeit weiterlaufenden nicht gedeckten Betriebsausgaben in angemessenem Umfang“ gem. § 56 Abs. 4 IfSG Umfang entstehen.
Schäden sind dabei so gering wie möglich zu halten. Dazu zählt auch die Arbeit im Home-Office.
Details zu den Abläufen (z.B. Antragstellung) bestimmt die zuständige Behörde. Diese wird von der Regierung des Landes bestimmt.
Achtung: Eine freiwillige Quarantäne oder ein generelles (gesundheitsunabhängiges) Tätigkeitsverbot (z.B. Betriebsschließungen im Einzelhandel) eröffnen keinen Entschädigungsanspruch nach dem IfSG.
Quelle: Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen
- Bedingungen für KfW-Unternehmerkredite (für Bestandsunternehmen) und ERP-Gründerkredit – Universell (für Unternehmen unter 5 Jahren) werden gelockert. Risikoübernahmen werden erhöht (bis zu 80 % für Betriebsmittelkredite bis 200 Mio. €). Die Instrumente stehen ferner auch größeren Unternehmen mit einem Umsatz von bis zu 2 Mrd. € (bisher: 500 Mio. €) zur Verfügung.
- Der KfW Kredit für Wachstum steht auch größeren Unternehmen zur Verfügung. Die bisherige Umsatzgröße von 2 Mrd. € wird auf 5 Mrd. € erhöht. Er wird für Vorhaben im Wege einer Konsortialfinanzierung ohne Beschränkung auf einen bestimmten Bereich (bislang: nur Innovation und Digitalisierung) zur Verfügung gestellt. Die Risikoübernahme wird auf bis zu 70 % (bisher 50 %) erhöht.
- Für Unternehmen mit mehr als 5 Mrd. € Umsatz erfolgt eine Unterstützung wie bisher nach Einzelfallprüfung KfW- und ERP-Kredite sind über Banken und Sparkassen bei der KfW zu beantragen. Informationen dazu gibt es auf der Webseite der KfW und bei allen Banken und Sparkassen.
- Die Bürgschaftsbanken verdoppeln den Bürgschaftshöchstbetrag auf 2,5 Mio. €. Bürgschaftsbanken können Bürgschaftsentscheidungen bis zu einem Betrag von 250.000 € eigenständig und innerhalb von drei Tagen treffen.
- Das eigentlich für Unternehmen in strukturschwachen Regionen aufgelegte Großbürgschaftsprogramm kann nun auf Unternehmen außerhalb dieser Regionen geöffnet.
- Darüber hinaus wird die KfW zusätzliche Sonderprogramme für alle entsprechenden Unternehmen auflegen, die krisenbedingt vorrübergehend in ernsthaftere Finanzierungsschwierigkeiten geraten. Dafür werden die Risikoübernahmen bei Investitionsmitteln deutlich verbessert und betragen bei Betriebsmitteln bis zu 80 %, bei Investitionen sogar bis 90 %. Ferner wird die KfW für größere Unternehmen Direktbeteiligungen im Rahmen von Konsortialfinanzierungen anbieten. Dieses neue KfW-Sonderprogramm soll in KW 13 starten Anträge können bereits ab sofort über den üblichen Weg der Hausbank eingereicht werden.
- Bund stellt Exportkreditgarantien (Hermesbürgschaften) bereit, um Unternehmen vor Zahlungsrisiken im Auslandsgeschäft zu schützen.
1. Einleitung
Die Anordnung von Kurzarbeit ermöglicht es Unternehmen, sozialverträglich die Arbeitszeit der Belegschaft vorübergehend herabzusetzen und so zum Beispiel auf konjunkturelle Schwankungen und damit einhergehende Auftragsrückgänge zu reagieren. Hierdurch können betriebsbedingte Kündigungen verhindert werden. Im Zuge der Kurzarbeit erhalten die Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld (KUG), das eine Leistung aus der Arbeitslosenversicherung darstellt. So können teilweise Entgelteinbußen aufgrund der Reduzierung der Arbeitszeit minimiert werden.
Das KUG muss bei der Agentur für Arbeit beantragt werden. Im Rahmen der Corona-Krise wurden die Voraussetzungen für die Gewährung des KUG gelockert. Hierfür wurde von der Bundesregierung am 13.03.2020 das „Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld“ veröffentlicht. Die Regelungen dieses Gesetzes sind zunächst bis zum 31.12.2020 befristet. Voraussetzungen für die Gewährung von KUG können nun zum Beispiel vorliegen, wenn aufgrund der Corona-Krise Lieferungen ausbleiben und dadurch die Arbeitszeit verringert werden muss, oder wenn staatliche Maßnahmen dafür sorgen, dass der Betrieb vorübergehend geschlossen werden muss. Das erleichterte KUG wird rückwirkend ab dem 01.03.2020 gezahlt.
Im Folgenden werden die allgemeinen Rahmenbedingen für den Erhalt des KUG erläutert. Zudem werden die speziellen Regelungen aufgrund der Corona-Krise näher thematisiert.
2. Rechtliche Voraussetzungen für KUG
2.1 Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer muss zunächst eine arbeitsrechtliche Reduzierung der Arbeitszeit im Betrieb vereinbart worden sein, mit der ein erheblicher Arbeitsausfall mit einem entsprechend reduzierten Entgelt einhergeht. Diese Vereinbarung kann zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat) oder bei Betrieben ohne organisierte Arbeitnehmervertretung direkt zwischen Arbeitgeber und den betroffenen Beschäftigten erfolgen. Das Gesetz stellt hier auf den Betrieb als organisatorische Einheit ab und nicht auf die Rechtsform. Bereits ab einem Arbeitnehmer im Betrieb kann KUG beantragt werden. Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmervertretung sind nicht gezwungen, der Kurzarbeit zuzustimmen. Die Verweigerung der Kurzarbeit allein ist kein Kündigungsgrund.
Die Vereinbarung über die Reduzierung der Arbeitszeit kann mit allen Mitarbeitern des Betriebs, einzelnen Abteilungen oder auch Sparten abgeschlossen werden, wenn der Arbeitsausfall sich nur auf abgegrenzte Bereiche erstreckt (z.B. bestimmte Produkt- und Fertigungslinien).
Hinweis: Corona-Regelungen
Im Rahmen der bis zum 31.12.2020 gültigen Maßnahmen angesichts der Corona-Krise können auch Beschäftigte in Leiharbeitsunternehmen vom KUG profitieren.
2.1.1 Vom KUG ausgeschlossene Arbeitnehmer
Bestimmte Arbeitnehmer sind allerdings vom Bezug von KUG ausgeschlossen. So haben sozialversicherungsfrei Beschäftigte keinen Anspruch auf KUG. Hierzu zählen zum Beispiel Arbeitnehmer, die das Lebensalter für den Anspruch auf Regelaltersrente vollendet haben, oder Arbeitnehmer in einer geringfügigen Beschäftigung.
Grundsätzlich muss der Arbeitnehmer vor der Kurzarbeitsphase bereits im Betrieb beschäftigt gewesen sein. Es gibt jedoch Ausnahmen, wenn zwingende Gründe vorliegen.
Beispiel
Ein Betrieb unter Kurzarbeit braucht einen Facharbeiter, um bestimmte betriebliche Aufgaben am Laufen zu halten.
Hier liegt ein zwingender Grund vor, so dass der Arbeitnehmer auch bei Arbeitsaufnahme in der Kurzarbeitsphase zum Bezug von KUG berechtigt ist.
Außerdem vom Bezug des KUG ausgeschlossen sind Bezieher von Krankengeld sowie Arbeitnehmer in geförderter beruflicher Weiterbildung.
2.1.2 Verpflichtung zur Arbeitsvermittlung
Das KUG ist gegenüber der Vermittlung von Arbeit nachrangig, deshalb wird ein Kurzarbeiter auch Angebote der Bundesagentur für Arbeit bekommen. Soweit er dann seine Mitwirkungspflichten nicht erfüllt, kann er vom Bezug des KUG ausgeschlossen werden.
2.2 Erheblicher Arbeits- und Entgeltausfall
Der Arbeitsausfall muss gemäß § 96 des Dritten Buchs Sozialgesetzbuch auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis beruhen.
Als wirtschaftliche Gründe gelten:
- Konjunkturbedingter Arbeitsmangel (z.B. aufgrund einer rezessionsbedingten Verminderung der Auftragseingänge und entsprechend sinkenden Absatzes),
- Kapitalmangel, durch den Handelswaren nicht mehr finanziert werden können (z.B. in einer allgemeinen Finanz- und Bankenkrise),
- Exportrückgänge aufgrund von Währungsturbulenzen oder Einfuhrbeschränkungen der Absatzstaaten,
- Mangel an Transportmöglichkeiten aufgrund einer Störung der Verkehrsmittel oder
- betriebliche Strukturveränderungen (diese müssen durch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung bedingt sein, z.B. Outsourcing, Produktionsumstellungen sowie notwendige Automatisierungsprozesse).
Kein wirtschaftlicher Grund liegt vor, wenn der Absatz deshalb zurückgeht, weil das Produkt des Unternehmens nicht mehr gekauft wird. Individuelle Absatz- und Geschäftsrisiken sind vom KUG nicht erfasst.
Als unabwendbare Ereignisse gelten zum Beispiel:
- Naturkatastrophen (z.B. Vulkanausbruch, Überschwemmung),
- behördliche Maßnahmen und Betriebsausfälle aufgrund einer Pandemie (z.B. Coronavirus).
Eine Störung des Betriebsablaufs durch normalen Witterungsverlauf (z.B. im Winter) ist noch kein unabwendbares Ereignis. Es müssen besondere Situationen vorliegen, die unüblich sind, etwa deutliche Abweichungen von langfristigen Wetteraufzeichnungen.
2.3 Vorübergehender und unvermeidbarer Arbeitsausfall
Der Arbeitsausfall darf nur vorübergehend sein; als Richtwert gelten zwölf Monate. Es muss glaubhaft gemacht werden, dass in absehbarer Zeit zur Vollbeschäftigung zurückgekehrt werden kann.
Hinweis
Als Argumente für einen nur kurzen Arbeitsausfall können zum Beispiel laufende Aufträge mit längerer Laufzeit bis zur Zahlung oder der Abschluss von notwendigen Anpassungsmaßnahmen angeführt werden.
Der Arbeitsausfall muss außerdem unvermeidbar sein. Betriebsseitig müssen vergeblich alle Maßnahmen zur Abwendung unternommen worden sein. Es müssen zum Beispiel Personalversetzungen geprüft werden, das heißt die Verlegung von Mitarbeitern in voll tätige Abteilungen, aber auch die Rückabwicklung von Outsourcing-Maßnahmen.
Hinweis
Es muss auch geprüft werden, ob der Arbeitsausfall durch Erholungsurlaub ganz oder teilweise vermieden werden kann. Urlaubswünsche und bereits genehmigter Urlaub sind zu berücksichtigen. Es ist daher nicht einfach, von der Belegschaft einzufordern, dass Urlaub zur Vermeidung der Kurzarbeit genommen werden soll.
Arbeitszeitguthaben der Mitarbeiter müssen grundsätzlich vorrangig aufgelöst und aufgebraucht werden. Allerdings gibt es bestimmte Fälle, in denen Arbeitszeitguthaben bestehen bleiben können:
- Guthaben zur Vermeidung von Saison-KUG, wenn sie 150 Stunden nicht übersteigen,
- Guthaben, die ausschließlich für bestimmte Zwecke nach § 7c Abs. 1 des Vierten Buchs Sozialgesetzbuch gebildet wurden, (z.B. für Langzeitpflege, berufliche Qualifizierungsmaßnahmen, längere Kinderbetreuung, Freistellungen oder vorgezogener Ruhestand),
- Guthaben, soweit sie 10 % der Jahresarbeitszeit des Arbeitnehmers übersteigen,
- Guthaben, die länger als ein Jahr unverändert bestanden haben.
Hinweis: Corona-Regelungen
Im Rahmen der bis zum 31.12.2020 gültigen Maßnahmen zur Corona-Krise müssen in Unternehmen mit entsprechenden Regelungen keine negativen Arbeitszeitsalden mehr aufgebaut werden.
Die vorrangige Gewährung von Urlaub vor Kurzarbeitergeld gilt jedoch, soweit möglich, nach wie vor.
2.4 Mindestvolumen des Arbeitsausfalls und der betroffenen Arbeitnehmer
Damit ein erheblicher Arbeitsausfall vorliegt, muss im jeweiligen Kalendermonat
- für mindestens ein Drittel der in dem Betrieb oder der betroffenen Betriebsabteilung beschäftigten Arbeitnehmer (Auszubildende werden nicht mitgerechnet)
- jeweils mehr als 10 % des monatlichen Bruttoentgelts durch die Kurzarbeit ausfallen.
Hinweis: Corona-Regelungen
Im Rahmen der bis zum 31.12.2020 befristeten Regelungen zur Bekämpfung der Auswirkungen der Corona-Krise wurde die notwendige Schwelle der betroffenen Arbeitnehmer je Betrieb von mindestens einem Drittel auf 10 % herabgesetzt.
Ist die Voraussetzung nicht erfüllt, kann kein KUG beantragt werden. Arbeitsausfälle, die diese Mindesterfordernisse nicht erfüllen, können nicht durch KUG ausgeglichen werden (Erheblichkeitsschwelle). Nach der Konzeption des Gesetzes sind diese Ausfälle durch innerbetriebliche Maßnahmen aufzufangen. Wird die Drittelvoraussetzung erfüllt, haben auch Arbeitnehmer mit einem Entgeltausfall von weniger als 10 % einen Anspruch auf KUG.
Für die Berechnung der 10-%-Entgeltausfallsschwelle muss das sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelt herangezogen werden; Beitragsbemessungsgrenzen gelten hier nicht.
In die Berechnung des Drittelerfordernisses sind grundsätzlich alle Arbeitnehmer einzubeziehen, die im fraglichen Gewährungszeitraum im Betrieb angestellt sind. Auch kranke und beurlaubte Arbeitnehmer sind in die Berechnung einzubeziehen.
Nicht einzubeziehen sind folgende Arbeitnehmer:
- Auszubildende,
- Arbeitnehmer in einer Weiterbildungsmaßnahme mit Anspruch auf Übergangsgeld,
- Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis ruht (z.B. wegen Entsendung), und
- Heimarbeiter.
3. Höhe des KUG
Das KUG berechnet sich nach dem Nettoentgeltausfall, der durch die verkürzten Arbeitszeiten bedingt ist. Grundsätzlich beträgt das KUG 60 % des ausgefallenen pauschalierten Nettoentgelts (sogenannter Leistungssatz 1). Lebt mindestens ein Kind mit im Haushalt, für das ein Kinderfreibetrag besteht, beträgt das KUG 67 % des ausgefallenen pauschalierten Nettoentgelts (sogenannter Leistungssatz 2).
Aus dem pauschalierten Nettoentgelt wird dann der sogenannte rechnerische Leistungssatz abgeleitet.
Hinweis
Die pauschalierten Leistungssätze lassen sich aus einer Tabelle der Bundesagentur für Arbeit unter folgendem Link entnehmen:
https://www.arbeitsagentur.de/datei/KUG050-2016_ba014803.pdf
Im Rahmen einer professionellen Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware sind die Daten zu den Leistungssätzen automatisch hinterlegt. Bei der Wahl des steuerlichen Faktorverfahrens nach § 39f Einkommensteuergesetz kann das KUG nur maschinell errechnet und nicht aus der Tabelle abgelesen werden.
Für die Berechnung der Höhe des Anspruchs muss zunächst das Soll-Entgelt ermittelt werden. Das Soll-Entgelt ist das eigentlich übliche monatliche Bruttoarbeitsentgelt ohne Mehrarbeitsentgelt und Einmalzahlungen. Dieses wird dem Ist-Entgelt, also dem tatsächlichen im Kalendermonat erzielten Bruttoarbeitsentgelt, gegenübergestellt. Aus beiden Beträgen werden dann jeweils die rechnerischen Leistungssätze ermittelt. Die Differenz zwischen den rechnerischen Leistungssätzen von Soll- und Ist-Entgelt ist dann der Betrag des Anspruchs auf KUG.
Beispiel
Ein Arbeitnehmer hat die Lohnsteuerklasse III und einen Kinderfreibetrag 1,0. Das übliche monatliche Nettoentgelt nach allen Abzügen ohne Berücksichtigung von Mehrarbeit und Einmalzahlungen beträgt 2.500 € (Soll-Entgelt). Durch die Arbeitszeitreduzierung mindert sich das monatliche Nettoentgelt auf 1.250 €.
Berechnung des KUG:
Mtl. Soll-Entgelt rechnerischer Leistungssatz
2.500 € 1.295,11 €
Mtl. Ist-Entgelt rechnerischer Leistungssatz
1.250 € 675,36 €
KUG 619,75 €
Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge können außerdem die Zahlung weiterer Aufstockungsbeträge zum KUG vorsehen.
4. Beantragung des KUG
4.1 Anzeige des Arbeitsausfalls
Zunächst muss der Arbeitsausfall der zuständigen Arbeitsagentur, in deren Bezirk der Betrieb liegt, angezeigt werden. Von der Anzeige hängt der Beginn des Anspruchs ab. KUG kann frühestens von dem Kalendermonat an geleistet werden, in dem die Anzeige eingegangen ist. Rückwirkende Anzeigen sind also grundsätzlich nicht möglich. Auf die Anzeige hin erlässt die jeweilige Arbeitsagentur entweder einen Anerkennungsbescheid oder einen Ablehnungsbescheid. Gegen einen Ablehnungsbescheid können dann gegebenenfalls Rechtsmittel eingelegt werden. Die Anzeige kann durch den Arbeitgeber oder die Arbeitnehmervertretung vorgenommen werden. Die Arbeitnehmer selbst sind nicht zur Anzeige berechtigt.
Die Anzeige muss schriftlich erfolgen. Eine Anzeige durch Telefax oder E-Mail ist also zulässig; eine mündliche oder telefonische Anzeige genügt hingegen nicht.
Mit der Anzeige ist glaubhaft zu machen, dass ein erheblicher Arbeitsausfall besteht und die betrieblichen Voraussetzungen für das KUG erfüllt sind. Dies ist kurz zu begründen.
Es sollte auch eine kurze Beschreibung des Betriebsteils erfolgen, in dem der Arbeitsausfall eintritt, getrennt nach Gesamtbetrieb und Betriebsabteilung. Außerdem sollte die Verteilung der verkürzten Arbeitszeit auf die Mitarbeiter dargestellt werden. Eine weiterführende Konkretisierung der Gründe des Arbeitsausfalls erfolgt dann mit dem Antrag im Leistungsverfahren.
Der Anzeige des Arbeitgebers ist, soweit vorhanden, auch eine Stellungnahme des Betriebsrats beizufügen.
4.2 Antrag auf KUG
Der Antrag auf KUG kann zeitlich mit der Anzeige des Arbeitsausfalls gestellt werden; er muss aber spätestens drei Monate nach dem jeweiligen Monat des Arbeitsausfalls bei der zuständigen Arbeitsagentur eingehen.
Der Antrag ist für jeden Abrechnungsmonat, in dem ein entsprechend erheblicher Arbeitsausfall vorliegt, erneut zu stellen. Im Antrag sind Soll- und Ist-Entgelt anzugeben. Dem Antrag ist außerdem die ausgefüllte Abrechnungsliste „Vordruck KUG 108“ beizufügen.
Der Vordruck fragt detaillierte Angaben ab, zum Beispiel:
- Namen der Mitarbeiter,
- Umfang des Arbeitsausfalls,
- Soll- und Ist-Entgelte,
- Lohnsteuerklassen,
- rechnerische Leistungssätze.
Diese Angaben sind mit den Informationen der Lohnakten zu bewältigen. Ferner wird auch erwartet, dass das KUG selbst berechnet wird. Hierfür stehen dann die Tabelle oder üblicherweise die Software des Lohn- und Gehaltsprogramms Ihres Steuerberaters zur Verfügung.
Hinweis
Sprechen Sie uns gerne auf diese Informationen an. Wir stehen Ihnen bei der Ausfüllung des Antrags zur Seite.
4.3 Bezugsdauer des KUG
Der Anspruch auf KUG ist gesetzlich auf zwölf Monate beschränkt. Da der Antrag für jeden Monat neu zu stellen ist, muss laufend überprüft werden, ob die Voraussetzungen eines erheblichen Arbeitsausfalls noch vorliegen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann bei außergewöhnlichen Verhältnissen auf dem gesamten Arbeitsmarkt diese Bezugsdauer bis auf insgesamt 24 Monate verlängern. Das KUG wird nur vorläufig gewährt. Nach dem Bezug des KUG wird der gesamte Vorgang von der Behörde noch einmal überprüft. Überzahlungen sind zurückzuerstatten.
4.4 Nebeneinkünfte des Arbeitnehmers
Wenn der Arbeitnehmer während des Bezugs des KUG eine Nebenbeschäftigung aufgenommen hat, werden die Einkünfte hieraus erhöhend auf das Ist-Entgelt angerechnet. Der Anspruch auf KUG vermindert sich also. Bezieher von KUG sind verpflichtet, alle Änderungen hinsichtlich ihrer Verhältnisse unaufgefordert anzuzeigen. Arbeitnehmer sollten also über diese Informationspflicht in Kenntnis gesetzt werden. Der Arbeitgeber muss die Information dann weiterleiten.
Hatte der Arbeitnehmer bereits vor Eintritt des Arbeitsausfalls eine Nebentätigkeit, genießt diese Bestandsschutz. Sie hat somit keine Auswirkung auf die Höhe des KUG.
Hinweis
Während des Bezugs von KUG wird von der Bundesagentur für Arbeit außerdem die Weiterbildung des Arbeitnehmers gefördert.
5. Steuer- und Sozialversicherung
5.1 Steuerliche Behandlung des KUG
Auf das KUG muss vom Unternehmer keine Lohnsteuer abgeführt werden; es handelt sich also um eine steuerfreie Leistung. Für den Arbeitnehmer gehören die Einkünfte aus dem KUG zu den Progressionseinkünften und erhöhen den persönlichen Steuersatz. Außerdem muss hierdurch eine Einkommensteuererklärung abgegeben werden.
5.2 Sozialversicherung
Während der Zeit der Gewährung von KUG bleibt der Arbeitnehmer in der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung versichert.
Für die Ausfallstunden aufgrund der Kurzarbeit werden die Beiträge zur gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung nach dem sogenannten fiktiven Arbeitsentgelt berechnet. Die Höhe dieser Beiträge errechnet sich durch
- 80 % des Unterschiedsbetrags zwischen dem Soll-Entgelt (brutto) und dem Ist-Entgelt (brutto) sowie
- dem Beitragssatz in der Krankenversicherung (allgemeiner plus Zusatzbeitragssatz), dem Beitragssatz der Pflegeversicherung (ohne den Beitragszuschlag für Kinderlose) und dem Beitragssatz der Rentenversicherung.
- In der Arbeitslosenversicherung ist das fiktive Entgelt beitragsfrei.
Die Sozialversicherungsbeiträge werden vom Arbeitgeber allein getragen.
Hinweis: Corona-Regelungen
Im Rahmen der bis zum 31.12.2020 befristeten Regelungen zur Bekämpfung der Auswirkungen der Corona-Krise werden den Arbeitgebern die Sozialversicherungsbeiträge, die sie bei Kurzarbeit zahlen müssen, in voller Höhe erstattet.
6 Spezialformen des KUG
6.1 Saison-KUG
Das Saison-KUG wird bei saisonbedingten Arbeitsausfällen in der Schlechtwetterzeit an Arbeitnehmer in Betrieben des Baugewerbes gezahlt. Ziel ist es, die Arbeitsverhältnisse während der Wintermonate aufrechtzuerhalten. Die Schlechtwetterzeit dauert vom 01.12. bis zum 31.03. des Folgejahres. Im Gerüstbauerhandwerk beginnt die Schlechtwetterzeit bereits am 01.11. und endet am 31.03. des Folgejahres.
Anspruchsberechtigt sind Betriebe, die im Bauhauptgewerbe (Geltungsbereich des Bundesrahmentarifvertrags Bau) oder dem Baunebengewerbe (Dachdeckerhandwerk, Garten- und Landschaftsbau) tätig sind.
6.2 Transfer-KUG
Bei betrieblichen Personalanpassungsmaßnahmen, die auf einer Betriebsänderung beruhen und mit einem dauerhaften Arbeitsausfall einhergehen, kann an die betroffenen Arbeitnehmer Transfer-KUG bei der Überführung in eine Transfergesellschaft gezahlt werden.
In diesem Zusammenhang können auch Leistungen zur Förderung der Teilnahme an Transfermaßnahmen, die der Eingliederung der Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt dienen, in Betracht kommen.
7. Fragen und Antworten zum KUG
Muss der Arbeitgeber für das KUG in Vorlage gehen?
Der Arbeitgeber berechnet das KUG und zahlt es an die Arbeitnehmer aus. Anschließend wird ein Erstattungsantrag bei der örtlichen Arbeitsagentur gestellt, die nach Prüfung der Antragsunterlagen dem Arbeitgeber das gezahlte KUG umgehend erstattet.
Müssen die Beschäftigten in einem Unternehmen ihre Arbeitszeit um jeweils den gleichen Prozentsatz reduzieren?
Es muss mindestens ein Drittel (bzw. befristet bis zum 31.12.2020 10 %) der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als 10 % ihres monatlichen Bruttoentgelts betroffen sein. Die Arbeitnehmer, die einen geringeren Arbeitsausfall als 30 % bzw. 10 % haben, können dann ebenso KUG beziehen.
Kann auch KUG beantragt werden, wenn im Gesamtunternehmen oder einem Teil der Arbeitsausfall 100 % beträgt?
Ja, eine „Kurzarbeit null“ mit einem kompletten Arbeitsausfall ist möglich. Es kann insoweit KUG beantragt werden.
Wie wirken sich bereits geschlossene Vereinbarungen zur Sicherung der Arbeitsplätze auf die Höhe des KUG aus?
Sogenannte Beschäftigungssicherungsvereinbarungen zur vorübergehenden Änderung der Arbeitszeit, die zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern bzw. der Arbeitnehmervertretung geschlossen wurden, wirken sich nicht negativ auf die Höhe des KUG aus. Das gezahlte KUG richtet sich nach dem Gehalt, das vor der Vereinbarung zur Beschäftigungssicherung gezahlt wurde.
Können auch gemeinnützige Unternehmen, zum Beispiel Vereine, KUG beantragen?
Ja, auch gemeinnützige Unternehmen können dem Grunde nach KUG erhalten.
Können Mitarbeiter in Kurzarbeit gekündigt werden?
Die Einführung von Kurzarbeit bei vorübergehendem Arbeitsausfall kann eine betriebsbedingte Kündigung unzulässig machen. Kurzarbeit schließt jedoch betriebsbedingte Kündigungen nicht aus, wenn die Beschäftigungsmöglichkeit der betreffenden Arbeitnehmer auf Dauer entfällt.
Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.
Rechtsstand: März 2020
Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-Merkblatt haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Diese Information kann eine individuelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.
Lieferengpässe, die im Zusammenhang mit dem Corona-Virus entstehen, oder behördliche Betriebsschließungen mit der Folge, dass Unternehmen ihre Produktion einschränken oder einstellen müssen, können zu einem Anspruch auf Kurzarbeitergeld für die vom Arbeitsausfall betroffenen Beschäftigten führen.
Die Bundesregierung hat hierzu die Voraussetzungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld erleichtert:
- Es reicht, wenn 10 Prozent der Beschäftigten eines Betriebes von Arbeitsausfall betroffen sind, damit ein Unternehmen Kurzarbeit beantragen kann. Bisher musste mindestens ein Drittel der Beschäftigten betroffen sein.
- Sozialversicherungsbeiträge werden bei Kurzarbeit von der Bundesagentur für Arbeit vollständig erstattet.
- Kurzarbeitergeld ist auch für Beschäftigte in Zeitarbeit möglich.
- In Betrieben, in denen Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankungen genutzt werden, wird auf den Aufbau negativer Arbeitszeitkonten verzichtet.
Diese Erleichterungen werden rückwirkend zum 1. März 2020 in Kraft treten und auch rückwirkend ausgezahlt.
Wichtig ist, dass die Unternehmen die Kurzarbeit im Bedarfsfall bei ihrer zuständigen Agentur für Arbeit anzeigen.
Ob die Voraussetzungen für die Gewährung des Kurzarbeitergelds vorliegen, prüft die zuständige Agentur für Arbeit im Einzelfall.
Kurzarbeitergeld kann für eine Dauer von bis zu zwölf Monaten bewilligt werden. Es wird in derselben Höhe wie Arbeitslosengeld bezahlt. Das Kurzarbeitergeld beträgt 60 Prozent der Differenz zwischen dem pauschalierten Nettoentgelt, das ohne Arbeitsausfall gezahlt worden wäre, und dem pauschaliertem Nettoentgelt aus dem tatsächlich erhaltenen Arbeitsentgelt. Es beträgt 67 Prozent, wenn mindestens ein Kind mit im Haushalt lebt.
Das BMAS hat sich am 15. März zur Frage der Lohnfortzahlung für Arbeitnehmer geäußert, die aufgrund der Betreuung ihrer Kinder vorübergehend nicht arbeiten können:
Nach geltender Rechtslage können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Betreuung ihrer Kinder für einen kurzen Zeitraum ohne Lohneinbußen ihrem Arbeitsplatz fernbleiben. Voraussetzung ist, dass sie ihre Kinder nicht anderweitig betreuen können (z.B. Ehepartner, Nachbarschaft). Auf die Betreuung durch Großeltern sollte verzichtet werden, da ältere Menschen erheblich durch das Virus gefährdet sind und deren Gesundheit besonders geschützt werden sollte. Diese rechtliche Möglichkeit nach § 616 BGB ist allerdings nach derzeitiger Rechtslage auf wenige, in der Regel zwei bis drei Tage, begrenzt. Außerdem kann § 616 BGB durch den Arbeitsvertrag oder einen Tarifvertrag abbedungen werden.
Das BMAS bittet angesichts der akuten Lage zu pragmatischen, unbürokratischen und einvernehmlichen Lösungen zu kommen, die nicht zu Lohneinbußen führen und die Möglichkeiten der Lohnfortzahlung im Betreuungsfall eher großzügig auszugestalten. Zumindest in der ersten Woche sollte aufgrund der akut notwendigen zwingenden Betreuung von Kindern keine Lohnminderung erfolgen. Wo möglich, könnten auch Homeoffice-Lösungen oder flexible Arbeitszeitregelungen dazu beitragen, die aktuelle Situation zu bewältigen. Arbeitnehmer könnten auch die Möglichkeit wahrnehmen, über Zeitausgleiche (z.B. Überstundenabbau) oder kurzfristige Inanspruchnahme von Urlaub, die Betreuung ihrer Kinder im Anschluss an die ersten Tage sicherzustellen.
Das BMAS prüft aktuell intensiv Wege, wie unzumutbare Lohneinbußen im Falle zwingend notwendiger Kinderbetreuung vermieden werden können. Diese Prüfung schließt den gesamten Zeitraum der behördlich angeordneten Schließung von Schulen und Kitas ein. BMAS und BMWi wollen möglichst schnell gemeinsam mit den Sozialpartnern tragfähige rechtliche Lösungen entwickeln.
Zur Eindämmung des Corona-Virus ordnen die zuständigen Behörden gegenwärtig oftmals eine Quarantäne gegenüber einzelnen Personen an. Sie wird gegenüber akut Erkrankten als auch für lediglich potentiell Infizierte ausgesprochen.
Bei Arbeitnehmern ist diese Unterscheidung maßgeblich für die Beurteilung, in welcher Form er weiterhin sein Gehalt bezieht:
a) Ist der Arbeitnehmer durch die Infizierung mit dem Corona-Virus arbeitsunfähig erkrankt, erhält er eine Fortzahlung des Gehaltes nach den üblichen Regelungen des Entgeltfortzahlungsgesetzes (EFZG). Die angeordnete Quarantäne-Maßnahme ändert hieran nichts.
b) Ist der Arbeitnehmer wegen des Verdachts auf eine mögliche Infektion in Quarantäne, greift § 56 Infektionsschutzgesetz (IfSG). Danach erhält der Arbeitnehmer eine Entschädigung für die ersten sechs Wochen der Quarantäne. Die Entschädigung zahlt der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer aus. Er bekommt sie aber auf Antrag von den zuständigen Behörden erstattet. Ab der siebten Quarantäne-Woche zahlen die zuständigen Behörden eine Entschädigung in Höhe des Krankengeldes direkt an den Arbeitnehmer.
Zur Höhe der Entschädigung:
Bei Angestellten in den ersten sechs Wochen Anspruch in Höhe des Nettogehaltes, danach in Höhe des gesetzlichen Krankengeldes. Zu beachten ist, dass die Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherungspflicht auch weiterhin besteht. Außerdem sind die Ansprüche nach dem Infektionsschutzgesetz nachrangig gegenüber allen anderen Ersatzansprüchen.
Ergänzung:
Im Fall angeordneter Betriebsschließungen durch die zuständigen Behörden gilt nach derzeitiger Rechtslage. Generell sind Betriebsschließungen ein Risiko, das der Arbeitgeber tragen muss. Die Arbeitnehmer haben danach auch weiterhin Anspruch auf Zahlung des Gehalts. In der derzeitigen Situation ist davon auszugehen, dass in den kommenden Tagen von Seiten der Bundesregierung mögliche Sonderregelungen auch für die Abwicklung behördlicher Betriebsschließungen geprüft werden.
Bundeshilfe für Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler
Antragsberechtige und Voraussetzungen:
Anträge können von Unternehmen, Solo-Selbstständigen und Freiberuflern gestellt werden.
Ziel:
Zuschuss zur Sicherung der wirtschaftlichen Existenz der Antragsteller und zur Überbrückung von akuten Liquiditätsengpässen, u.a. durch laufende Betriebskosten wie Mieten, Kredite für Betriebsräume, Leasingraten u.ä (auch komplementär zu den Länderprogrammen)
Voraussetzung:
Wirtschaftliche Schwierigkeiten in Folge von Corona. Unternehmen darf vor März 2020 nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten gewesen sein. Schadenseintritt nach dem 11. März 2020. Existenzbedrohung bzw. Liquiditätsengpass bedingt durch Corona sind zu versichern.
Höhe der Soforthilfe des Bundes:
- 9.000 Euro für 3 Monate für Antragsberechtigte mit bis zu 5 Beschäftigten
- 15.000 Euro für 3 Monate für Antragsberechtigte mit bis zu 10 Beschäftigten
Rückzahlung:
Die Soforthilfe des Bundes muss nicht zurückerstattet werden. Kumulierung mit anderen Beihilfen im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, aber auch mit bestehenden deminimis-Beihilfen grundsätzlich möglich. Eine Überkompensation ist zurückzuzahlen. Bei der Steuerveranlagung für die Einkommens – oder Körperschaftsteuer im kommenden Jahr wird dieser Zuschuss gewinnwirksam berücksichtigt. Gegebenenfalls müssen aber Zuschüsse bei Inanspruchnahme der Soforthilfe der Länder zurückgezahlt werden. Dies gilt es zu überprüfen.
Beantragung:
Anträge können ab sofort gestellt werden. Gerne unterstützen wir Sie hierbei.
Baden-Württemberg
Antragsberechtige und Voraussetzungen:
Anträge können von Unternehmen, Solo-Selbstständigen und Freiberuflern, einschließlich Künstler, mit bis zu 50 Beschäftigten gestellt werden, die ihren Hauptsitz in Baden-Württemberg haben.
Solo-Selbständige und Kleinstunternehmen mit unter fünf Beschäftigten sind nur insoweit antragsberechtigt, als dass sie mit ihrer selbständigen Tätigkeit das Haupteinkommen oder zumindest ein Drittel des Nettoeinkommens eines Haushalts bestreiten.
Liquiditätsengpässe oder Umsatzeinbrüche, die bereits vor dem 11. März 2020 entstanden sind, sind nicht förderfähig.
Höhe der Soforthilfe in Baden-Württemberg:
- 9.000 Euro für 3 Monate für Antragsberechtigte mit bis zu 5 Beschäftigten
- 15.000 Euro für 3 Monate für Antragsberechtigte mit bis zu 10 Beschäftigten
- 30.000 Euro für 3 Monate für Antragsberechtigte mit bis zu 50 Beschäftigten
Rückzahlung:
Die Soforthilfe des Landes Baden-Württemberg muss voraussichtlich nicht zurückerstattet werden. Gegebenenfalls müssen aber Zuschüsse bei Inanspruchnahme der Soforthilfe des Bundes zurückgezahlt werden. Dies gilt es zu überprüfen.
Beantragung:
Anträge können ab sofort gestellt werden. Gerne unterstützen wir Sie hierbei.
Bayern
Antragsberechtigte und Voraussetzungen:
Soforthilfe für Selbstständige und Freiberufler, die ihren Sitz in Bayern haben.
Höhe der Soforthilfe in Bayern:
- 5.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 5 Beschäftigten
- 7.500 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 10 Beschäftigten
- 15.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 50 Beschäftigten
- 30.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 250 Beschäftigten
Rückzahlung:
Die Soforthilfe des Landes Bayern muss voraussichtlich nicht zurückerstattet werden. Gegebenenfalls müssen aber Zuschüsse bei Inanspruchnahme der Soforthilfe des Bundes zurückgezahlt werden. Dies gilt es zu überprüfen.
Beantragung:
Anträge können ab sofort gestellt werden. Gerne unterstützen wir Sie hierbei.
Berlin
Antragsberechtige und Voraussetzungen:
Anträge können von Unternehmen, Solo-Selbstständigen und Freiberuflern, einschließlich Künstler, mit bis zu 5 Beschäftigten gestellt werden, die ihren Hauptsitz in Berlin haben.
Höhe der Soforthilfe in Berlin:
- Steht noch nicht endgültig fest. Wir werden die Daten aber sofort aktualisieren, sobald hier konkretes zu vermelden ist.
Rückzahlung:
Die Soforthilfe des Landes Berlin muss voraussichtlich nicht zurückerstattet werden. Gegebenenfalls müssen aber Zuschüsse bei Inanspruchnahme der Soforthilfe des Bundes zurückgezahlt werden. Dies gilt es zu überprüfen.
Beantragung:
Anträge können aktuell noch nicht gestellt werden. Gerne unterstützen wir Sie hierbei.
Brandenburg
Antragsberechtige und Voraussetzungen:
Anträge können von Unternehmen, Solo-Selbstständigen und Freiberuflern mit bis zu 100 Beschäftigten gestellt werden, die ihren Sitz in Brandenburg haben.
Höhe der Soforthilfe in Brandenburg:
- 5.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 2 Beschäftigten
- 10.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 5 Beschäftigten
- 15.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 15 Beschäftigten
- 30.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 50 Beschäftigten
- 60.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 100 Beschäftigten
Rückzahlung:
Die Soforthilfe des Landes Brandenburg muss voraussichtlich nicht zurückerstattet werden. Gegebenenfalls müssen aber Zuschüsse bei Inanspruchnahme der Soforthilfe des Bundes zurückgezahlt werden. Dies gilt es zu überprüfen.
Beantragung:
Anträge können ab sofort gestellt werden. Gerne unterstützen wir Sie hierbei.
Bremen
Antragsberechtige und Voraussetzungen:
Anträge können von Unternehmen, Solo-Selbstständigen und Freiberuflern mit bis zu 10 Beschäftigten und weniger als 2 Millionen Euro Umsatz gestellt werden, die ihren Sitz in Bremen und Bremerhaven haben.
Höhe der Soforthilfe in Bremen:
- 5.000 Euro, in Einzelfällen bis 20.000 Euro
Rückzahlung:
Die Soforthilfe des Landes Bremen muss voraussichtlich nicht zurückerstattet werden. Gegebenenfalls müssen aber Zuschüsse bei Inanspruchnahme der Soforthilfe des Bundes zurückgezahlt werden. Dies gilt es zu überprüfen.
Beantragung:
Anträge können ab sofort gestellt werden. Gerne unterstützen wir Sie hierbei.
Hamburg
Antragsberechtige und Voraussetzungen:
Anträge können von Unternehmen, Solo-Selbstständigen und Freiberuflern gestellt werden, die ihren Sitz in Hamburg haben.
Höhe der Soforthilfe in Hamburg:
- 2.500 Euro für Antragsberechtigte Einzelkämpfer
- 5.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 10 Beschäftigten
- 10.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 50 Beschäftigten
- 25.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 250 Beschäftigten
Rückzahlung:
Die Soforthilfe des Landes Hamburg muss voraussichtlich nicht zurückerstattet werden. Gegebenenfalls müssen aber Zuschüsse bei Inanspruchnahme der Soforthilfe des Bundes zurückgezahlt werden. Dies gilt es zu überprüfen.
Beantragung:
Anträge können ab sofort gestellt werden. Gerne unterstützen wir Sie hierbei.
Hessen
Antragsberechtige und Voraussetzungen:
Anträge können von Unternehmen, Solo-Selbstständigen und Freiberuflern gestellt werden, die ihren Sitz in Hessen haben.
Höhe der Soforthilfe in Hessen:
- 10.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 5 Beschäftigten
- 20.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 10 Beschäftigten
- 30.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 50 Beschäftigten
Rückzahlung:
Die Soforthilfe des Landes Hessen muss voraussichtlich nicht zurückerstattet werden, sondern setzt auf der Soforthilfe des Bundes auf.
Beantragung:
Anträge können ab sofort gestellt werden. Gerne unterstützen wir Sie hierbei.
Mecklenburg-Vorpommern
Antragsberechtige und Voraussetzungen:
Anträge können von Unternehmen, Solo-Selbstständigen und Freiberuflern gestellt werden, die ihren Sitz in Mecklenburg-Vorpommern haben.
Höhe der Soforthilfe in Mecklenburg-Vorpommern:
- Darlehen bis zu 200.000 Euro für Antragsberechtigte
Rückzahlung:
- Darlehen bis 20.000 Euro, zinsfrei, 5 Jahre Laufzeit
- Darlehen bis 200.000 Euro, zins- und tilgungsfrei im 1. Jahr, 3,69% p.a. ab 2. Jahr
Beantragung:
Anträge können ab sofort gestellt werden. Gerne unterstützen wir Sie hierbei.
Niedersachsen
Antragsberechtige und Voraussetzungen:
Anträge können von Unternehmen, Solo-Selbstständigen und Freiberuflern gestellt werden, die ihren Sitz in Niedersachsen haben.
Höhe der Soforthilfe in Niedersachsen:
- 3.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 5 Beschäftigten
- 5.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 10 Beschäftigten
- 10.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 30 Beschäftigten
- 20.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 49 Beschäftigten
Rückzahlung:
Die Soforthilfe des Landes Niedersachsen muss voraussichtlich nicht zurückerstattet werden. Gegebenenfalls müssen aber Zuschüsse bei Inanspruchnahme der Soforthilfe des Bundes zurückgezahlt werden. Dies gilt es zu überprüfen.
Beantragung:
Anträge können ab sofort gestellt werden. Gerne unterstützen wir Sie hierbei.
Nordrhein-Westfalen
Antragsberechtige und Voraussetzungen:
Anträge können von Unternehmen und Freiberuflern gestellt werden, die ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen haben.
Höhe der Soforthilfe in Nordrhein-Westfalen:
- 25.000 Euro für Antragsberechtigte mit 10 bis zu 50 Beschäftigten
- 2.000 Euro für Künstler
Rückzahlung:
Die Soforthilfe des Landes Nordrhein-Westfalen muss voraussichtlich nicht zurückerstattet werden und kann als Ergänzung zur Soforthilfe des Bundes beantragt werden.
Beantragung:
Anträge können ab sofort gestellt werden. Gerne unterstützen wir Sie hierbei.
Rheinland-Pfalz
Antragsberechtige und Voraussetzungen:
Anträge können von Unternehmen, Solo-Selbstständigen und Freiberuflern gestellt werden, die ihren Sitz in Rheinland-Pfalz haben.
Höhe der Soforthilfe in Rheinland-Pfalz:
- 10.000 Euro Sofortdarlehen für Antragsberechtigte mit bis zu 10 Beschäftigten
- 30.000 Euro Sofortdarlehen zzgl. 30% der Darlehenssumme als Landeszuschuss für Antragsberechtigte mit 10 bis zu 30 Beschäftigten
Rückzahlung:
Die Soforthilfe des Landes Rheinland-Pfalz muss voraussichtlich nicht zurückerstattet werden, das Sofortdarlehen aber schon. Das Programm ergänzt die Soforthilfe des Bundes.
Beantragung:
Anträge können aktuell noch nicht gestellt werden. Gerne unterstützen wir Sie hierbei.
Saarland
Antragsberechtige und Voraussetzungen:
Anträge können von Unternehmen, Solo-Selbstständigen, Freiberuflern und Künstler mit bis zu 10 Beschäftigten, maximal 700.000 Euro Umsatz oder 350.000 Euro Bilanzsumme gestellt werden, die ihren Sitz im Saarland haben.
Höhe der Soforthilfe im Saarland:
- 3.000 Euro bis 10.000 Euro
Rückzahlung:
Die Soforthilfe des Landes Saarland muss voraussichtlich nicht zurückerstattet werden. Gegebenenfalls müssen aber Zuschüsse bei Inanspruchnahme der Soforthilfe des Bundes zurückgezahlt werden. Dies gilt es zu überprüfen.
Beantragung:
Anträge können ab sofort gestellt werden. Gerne unterstützen wir Sie hierbei.
Sachsen
Antragsberechtige und Voraussetzungen:
Anträge können von Unternehmen, Solo-Selbstständigen und Freiberuflern gestellt werden, die ihren Sitz in Sachsen haben.
Höhe der Soforthilfe in Sachsen:
- Darlehen bis zu 100.000 Euro für Antragsberechtigte
Rückzahlung:
- Zinslos, 10 Jahre Laufzeit davon 3 tilgungsfreie Jahre
Beantragung:
Anträge können ab sofort gestellt werden. Gerne unterstützen wir Sie hierbei.
Sachsen-Anhalt
Aktuell liegt kein Soforthilfe Programm für Sachsen-Anhalt vor.
Schleswig-Holstein
Antragsberechtige und Voraussetzungen:
Anträge können von Unternehmen, Solo-Selbstständigen und Freiberuflern gestellt werden, die ihren Sitz in Schleswig-Holstein haben.
Höhe der Soforthilfe in Schleswig-Holstein:
- 2.500 Euro für Antragsberechtigte Einzelkämpfer
- 5.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 5 Beschäftigten
- 10.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 10 Beschäftigten
Rückzahlung:
Die Soforthilfe des Landes Schleswig-Holstein muss voraussichtlich nicht zurückerstattet werden. Gegebenenfalls müssen aber Zuschüsse bei Inanspruchnahme der Soforthilfe des Bundes zurückgezahlt werden. Dies gilt es zu überprüfen.
Beantragung:
Anträge können aktuell noch nicht gestellt werden. Gerne unterstützen wir Sie hierbei.
Thüringen
Antragsberechtige und Voraussetzungen:
Anträge können von Unternehmen, Solo-Selbstständigen und Freiberuflern gestellt werden, die ihren Sitz in Thüringen haben.
Höhe der Soforthilfe in Thüringen:
- 5.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 5 Beschäftigten
- 10.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 10 Beschäftigten
- 20.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 25 Beschäftigten
- 30.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 50 Beschäftigten
Rückzahlung:
Die Soforthilfe des Landes Thüringen muss nicht zurückerstattet werden. Gegebenenfalls müssen aber Zuschüsse bei Inanspruchnahme der Soforthilfe des Bundes zurückgezahlt werden. Dies gilt es zu überprüfen.
Beantragung:
Anträge können ab sofort gestellt werden. Gerne unterstützen wir Sie hierbei.
Mittels BMF-Schreibens bzw. gleich lautender Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 19.3.2020 wurden folgende Erleichterungen umgesetzt:
a) Die nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich betroffenen Steuerpflichtigen können bei ihrem Finanzamt bis zum 31.12.2020 unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf Stundung der bis zu diesem Zeitpunkt bereits fälligen oder fällig werdenden Steuern, die von den Landesfinanzbehörden im Auftrag des Bundes verwaltet werden (z.B. Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer), stellen. Für etwaige Stundungs- und Erlassanträge die Gewerbesteuer betreffend gilt, dass diese grundsätzlich an die Gemeinden zu richten sind. Sie sind nur dann an das zuständige Finanzamt zu richten, wenn die Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer nicht den Gemeinden übertragen worden ist.
Achtung: Steuerabzugsbeträge (Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer) können nicht gestundet werden.
b) Die nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich betroffenen Steuerpflichtigen können bis zum 31.12.2020 unter Darlegung ihrer Verhältnisse beim zuständigen Finanzamt Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer stellen. Ferner können Steuerpflichtige in diesen Fällen Anträge auf Herabsetzung des Gewerbesteuermessbetrags für Zwecke der Vorauszahlung stellen. Nimmt das Finanzamt eine Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrages für Zwecke der Vorauszahlungen vor, ist die betreffende Gemeinde hieran bei der Festsetzung ihrer Gewerbesteuer Vorauszahlungen gebunden.
Der Steuerpflichtige muss für diese Anträge die entstandenen Schäden wertmäßig nicht im Einzelnen nachweisen können. Bei der Nachprüfung der Voraussetzungen für Stundungen sind keine strengen Anforderungen zu stellen. Auf die Erhebung von Stundungszinsen kann in der Regel verzichtet werden. Stundungsanträge für fällige Steuern nach dem 31.12.2020 bzw. Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen, die Zeiträume nach dem 31.12.2020 betreffen, sind besonders zu begründen.
c) Bis zum 31.12.2020 soll auf Vollstreckungsmaßnahmen für rückständige oder bis zu diesem Zeitpunkt fällig werdende von den Landesfinanzbehörden verwaltete Steuern (z.B. Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer) abgesehen werden. Voraussetzung ist, dass dem Finanzamt aufgrund Mitteilung des Vollstreckungsschuldners oder auf andere Weise bekannt wird, dass der Vollstreckungsschuldner unmittelbar und nicht unerheblich betroffen ist.
Die Möglichkeit einer Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen ist in § 76 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB IV geregelt.
Danach dürfen Ansprüche auf den Gesamtsozialversicherungsbeitrag dann gestundet werden, wenn die sofortige Einziehung mit erheblichen Härten für das Unternehmen verbunden wäre und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet wird.
Eine erhebliche Härte für das Unternehmen ist gegeben, wenn es sich aufgrund ungünstiger wirtschaftlicher Verhältnisse vorübergehend in ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten befindet oder im Falle der sofortigen Einziehung der fälligen Sozialversicherungsabgaben in diese geraten würde.
Eine Stundung darf allerdings nicht gewährt werden, wenn eine Gefährdung des Anspruches eintreten würde. Das ist der Fall, wenn die Zahlungsschwierigkeiten nicht nur vorübergehend sind oder eine Überschuldung in absehbarer Zeit offensichtlich nicht abgebaut werden kann.
Den Antrag können wir gerne für Sie stellen. Bitte sprechen Sie uns an.
Das Land Hessen setzt auf Antrag die 2020 gezahlte Sondervorauszahlung der Umsatzsteuer auf „Null“ herab, so dass getätigte Sondervorauszahlungen erstattet werden. Den Antrag können Steuerpflichtige formlos oder über ELSTER stellen. Quelle: (Pressemitteilung vom 19.03.2020).
Auch Die Finanzämter in Nordrhein-Westfalen setzen auf Antrag die Sondervorauszahlungen für Dauerfristverlängerungen bei der Umsatzsteuer für krisenbetroffene Unternehmen bis auf „Null“ fest.